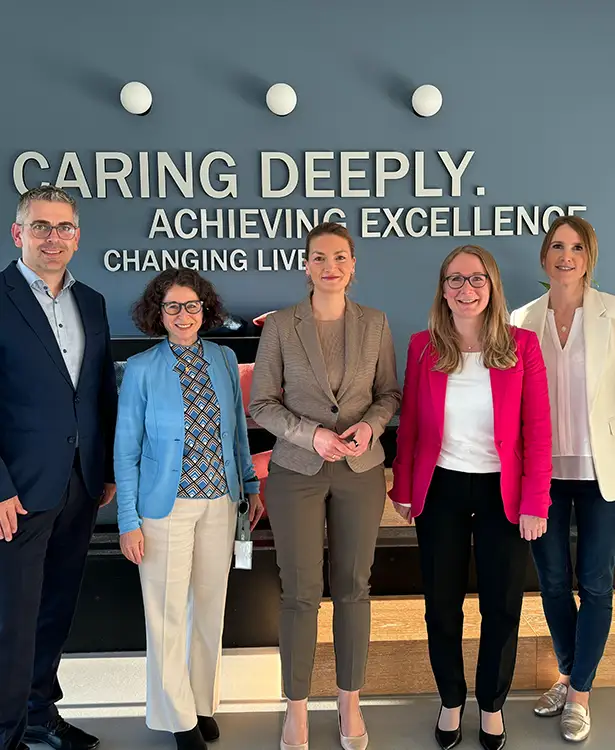Rund 4 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer seltenen Erkrankung – oft ohne klare Diagnose. Im Schnitt vergehen sechs bis sieben Jahre, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Dabei ist eine frühe Erkennung entscheidend, denn eine Behandlung in den frühen Krankheitsstadien kann die Lebensqualität erheblich verbessern.Obwohl weltweit etwa 8.000 seltene Krankheiten bekannt sind, sind viele noch kaum erforscht. Prof. Dr. med. Christoph Kleinschnitz, Direktor der Neurologie am Universitätsklinikum Essen, erklärt im Interview, wie digitale Medizin und neue Behandlungen die Versorgung verbessern können und warum mehr Forschung, Aufklärung und Vernetzung dringend notwendig sind.
Prof. Dr. med. Christoph Kleinschnitz
Herr Professor Kleinschnitz, mit welchen Herausforderungen sehen sich Patienten mit seltenen Erkrankungen konfrontiert?
Die erste große Herausforderung für Betroffene seltener Erkrankungen ist es, überhaupt die richtige Diagnose zu erhalten. Im Durchschnitt dauert es 6 – 7 Jahre, bis eine seltene Erkrankung erkannt wird – oft, weil das Wissen dazu sowohl beim medizinischen Personal als auch in der Öffentlichkeit noch unzureichend ist. Ein großes Problem ist außerdem die Identifikation und rechtzeitige Überweisung der Patient:innen an spezialisierte Zentren. Dabei sind diese Einrichtungen gerade bei seltenen Erkrankungen von zentraler Bedeutung: Hier bündelt sich Expertise und es können Forschungsprojekte sowie Studien initiiert werden. Auch für das Gesundheitssystem stellt die Versorgung eine enorme Herausforderung dar – sowohl personell als auch finanziell, was bislang nicht ausreichend berücksichtigt wird. Am dringendsten brauchen wir daher eine bessere Finanzierung und hochwertige Fortbildungsangebote, um die Versorgung und Diagnostik für Menschen mit seltenen Erkrankungen zu verbessern.
Mit welchen Problemen sind die Patienten im Alltag konfrontiert?
Leider erleben viele, dass ihren Symptomen zunächst wenig Glauben geschenkt wird – auch durch medizinisches Fachpersonal. Diagnosen werden fälschlich auf psychische Ursachen geschoben, dadurch bleibt die notwendige Diagnostik aus. Hinzu kommen spezifische Funktionseinschränkungen, die bei den meisten seltenen Erkrankungen auftreten: Sie führen nicht selten zu Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und beeinträchtigen die soziale Teilhabe der Betroffenen. Maßnahmen zur besseren Inklusion sind daher unerlässlich.
Spinale Muskelatrophie (SMA), zählt zu den seltenen Erkrankungen. Was sind die besonderen Merkmale dieser Krankheit und wie sieht hier die Versorgung aus?
Die spinale Muskelatrophie (SMA) ist eine seltene, genetisch bedingte neuromuskuläre Erkrankung, die durch den fortschreitenden Verlust motorischer Nervenzellen im Rückenmark gekennzeichnet ist, was zu schweren Lähmungen führen kann. Die Behandlung von SMA-Patient:innen ist komplex. Neben medikamentösen Therapien sind Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie sowie internistische Betreuung essenziell. Entscheidend für den Therapieerfolg ist der möglichst frühe Behandlungsstart. Ziel ist es, bei Kindern eine möglichst normale Entwicklung zu ermöglichen und bei Erwachsenen den Funktionsverlust zu bremsen oder sogar zu verbessern.
Angesichts der komplexen Versorgung und der hohen Anforderungen an die Therapie: Wie können innovative Ansätze und Forschung die Behandlung von Menschen mit seltenen Erkrankungen verbessern?
Digitale Technologien und künstliche Intelligenz bieten großes Potenzial, seltene Erkrankungen schneller zu diagnostizieren, indem sie große Mengen an medizinischem Wissen auswerten und auch ungewöhnliche Befundmuster erkennen. Bereits heute erleichtern digitale Lösungen den Alltag von Patient:innen. Telemedizin ermöglicht Verlaufskontrollen ohne Klinikbesuch, was insbesondere Menschen mit eingeschränkter Mobilität entlastet. Zudem erfassen digitale Tools wichtige Funktionsparameter und stellen diese den behandelnden Ärzt:innen direkt zur Verfügung. Bei Neudiagnosen oder Therapieanpassungen ist jedoch weiterhin ein persönlicher Termin vor Ort unerlässlich. Auch Gesundheits-Apps unterstützen Patient:innen – etwa bei physiotherapeutischen Übungen oder kognitivem Training. Damit digitale Anwendungen ihr Potenzial voll ausschöpfen, müssen sie ihren Nutzen jedoch stärker durch wissenschaftliche Studien belegen, ähnlich wie Medikamente.
Wie lässt sich die Forschung zu seltenen Erkrankungen weiter stärken?
Für den medizinischen Fortschritt ist eine enge Zusammenarbeit zwischen akademischer Forschung, spezialisierten Zentren und der pharmazeutischen Industrie entscheidend. Politik und Gesellschaft sollten ein innovationsfreundliches Umfeld schaffen – etwa durch gezielte Forschungsprogramme und die Unterstützung von Patientennetzwerken. Durch mehr Aufklärung kann zudem das Bewusstsein für seltene Erkrankungen in der Bevölkerung gestärkt werden.
Prof. Dr. med. Christoph Kleinschnitz ist Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen. Sein Spezialgebiet ist die Erforschung von neurovaskulären und neuroimmunologischen Erkrankungen, zu denen auch einige seltene Krankheiten gehören. Sein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Forschung zu Schlaganfällen und Multipler Sklerose (MS).